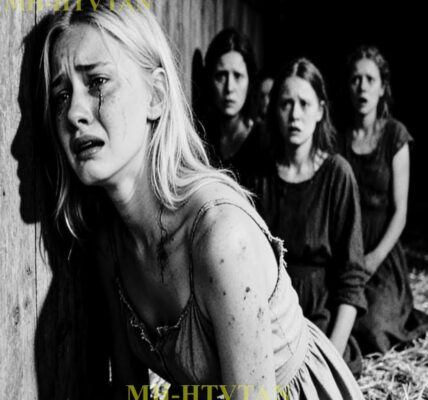Im Jahr 1945, in den letzten, verzweifelten Monaten des Zweiten Weltkriegs, kämpfte die deutsche Infanterie in den Trümmern des eigenen Landes. Die Alliierten standen bereits tief im deutschen Territorium, und an vielen Frontabschnitten tobten erbitterte Gefechte. Die deutschen Soldaten setzten eine Vielzahl von Waffen ein, um die vorrückenden feindlichen Truppen aufzuhalten: Flammenwerfer, Maschinenpistolen, Gewehre, leichte und schwere Artillerie sowie Handgranaten.
Die Flammenwerfer, gefürchtet wegen ihrer verheerenden Wirkung in Nahkämpfen, kamen besonders in zerstörten Städten, Schützengräben und Bunkeranlagen zum Einsatz. Kleinwaffenfeuer hallte über das Schlachtfeld, während Geschützstellungen unablässig feuerten, um Panzer und Infanterie der Alliierten zurückzudrängen. Explosionen von Granaten und Handgranaten rissen Krater in den Boden und schleuderten Erde und Trümmer durch die Luft.
Trotz des Einsatzes all dieser Waffen war die Lage für die deutsche Seite aussichtslos. Die Wehrmacht litt unter massiven Versorgungsengpässen, Munitionsmangel und dem Verlust erfahrener Soldaten. Die verbliebenen Einheiten bestanden oft aus unerfahrenen Rekruten, Volkssturmeinheiten und versprengten Frontkämpfern, die unter größter Anstrengung versuchten, den Vormarsch der Alliierten zu verlangsamen.
Diese Kämpfe zeichneten sich durch eine extreme Härte und hohe Verluste auf beiden Seiten aus. In vielen Städten verwandelten sich Straßenzüge in Brennpunkte des Widerstands, doch der militärische Druck der Alliierten wuchs unaufhaltsam. Der Einsatz von Flammenwerfern und anderen Waffen konnte den Zusammenbruch der Front nicht verhindern.
Die Gefechte von 1945 in Deutschland symbolisieren den verzweifelten Endkampf eines Regimes, das kurz vor seinem Untergang stand. Für viele Soldaten bedeutete dieser Einsatz nicht nur den letzten Kampf, sondern auch das Ende einer Epoche, die Europa in Trümmer gelegt hatte.