Orbáns Donner: Wie ein wütender Abgang in Brüssel die 140-Milliarden-Euro-Kriegskasse der EU ins Chaos stürzte
Orbáns Donner: Wie ein wütender Abgang in Brüssel die 140-Milliarden-Euro-Kriegskasse der EU ins Chaos stürzte

Article: Die Bühne des Europäischen Rates sollte die unerschütterliche Einheit des Kontinents demonstrieren, insbesondere im Angesicht der anhaltenden geopolitischen Spannungen. Doch was sich hinter verschlossenen Türen abspielte, war weniger ein Akt der Einigkeit als vielmehr ein explosives Drama, das die tiefen Risse und die wachsende Verzweiflung im Herzen der europäischen Machtzentrale offenlegte. Die Ankunft des ungarischen Premierministers Viktor Orbán beim Gipfel am 23. Oktober verwandelte ein scheinbar harmloses Treffen zur Koordination weiterer Hilfen in einen Schauplatz des Aufruhrs. Mit einem kurzen, trotzigen Friedensappell, der die 26 anderen Staats- und Regierungschefs in Schockstarre zurückließ, beendete Orbán seine Rede, drehte sich um und verließ wütend den Raum. Sein dramatischer Abgang war nicht nur ein politisches Statement, sondern die Zündung einer Bombe, die Europas größten Finanzplan für die Ukraine in pures Chaos stürzte.
Der Augenblick des Schocks: Orbáns wütender Abgang
Zunächst schien es, als würde der Gipfel nach dem üblichen Drehbuch ablaufen. Die Atmosphäre war gelöst, geprägt von Lächeln, Small Talk und Händeschütteln. Lediglich eine offizielle Mitteilung über Orbáns verspätete Ankunft ließ Bürokraten schmunzeln: Ihr vermeintlich letzter Stolperstein war nicht anwesend, um die erwartete Blockade zu inszenieren. Während Ursula von der Leyen ihre gewohnten, theatralischen Zeilen vortrug und loyale Partner wie Friedrich Merz ihr ergeben nickten, hing eine ungesagte Frage in der Luft: Würde Europa sich selbst zerstören, um Kiew zu retten? Würde es blind in einen weiteren Niedergang marschieren, eine „Drohnenmauer“ errichten, Vermögen beschlagnahmen und damit die letzten Lebensadern seiner Industrie kappen?
Die Tagesordnung klang harmlos: „Mehr Hilfe, mehr moralische Unterstützung“. Doch die eigentliche Agenda war die tiefgreifendste Involvierung Europas in den Konflikt seit seinem Beginn. Die Gipfelteilnehmer diskutierten nicht nur Milliarden für Kiew, sondern langfristige Kredite und haushaltspolitische Hilfen, die Europa auf Jahre hinaus an die ukrainische Wirtschaft ketten würden – ungeachtet der politischen Kosten und des Wählerwillens in Deutschland, Frankreich, Ungarn und den Niederlanden, die längst nach Frieden riefen.
Gerade als sich der alte Film der Einheit wiederholen sollte, erhob sich Orbán, direkt aus Budapest, wo zehntausende beim Friedensmarsch gegen den Brüsseler „Eskalationswahn“ demonstriert hatten. Er sah sich um und sagte die Worte, die den Raum erstarren ließen: „Genug von diesem Wahnsinn.“
Die geheime Tagesordnung: Europas Marsch in den Niedergang
Orbáns Einwand war nicht einfach nur das Veto gegen ein weiteres Hilfspaket. Er warnte mit brutaler Klarheit, dass die EU im Begriff war, eine gefährliche rote Linie zu überschreiten. Der Gipfel sollte Europas Probleme zu den Problemen der Union erklären und die gesamte wirtschaftliche Lebensader des Kontinents an Kiews Überleben binden. Das geplante Sanktionspaket – das 19. seiner Art – beinhaltete zum ersten Mal eine direkte Maßnahme gegen Russlands Gassektor. Doch die eigentliche „Krönung“ des Treffens war der Plan zur Beschlagnahmung von eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Höhe von 140 Milliarden Euro.
Sobald dieser Plan unterzeichnet würde, so Orbán, würde Europa die Grenze vom Sponsor zum Kriegsakteur überschreiten. Er hielt der EU den Spiegel vor und warf ihr vor, sich so tief in den Konflikt hineingezogen zu haben, dass sie in Wahrheit Kiew erst dazu ermutigt hätte, die Spannungen aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig die Friedensbemühungen anderer blockierte. Seine Kernaussage richtete sich dabei nicht gegen die europäische Idee als Ganzes, sondern scharf gegen die Brüsseler Bürokratie: „Ja zur Europäischen Union, nein zu Brüssel. Ja zur Zusammenarbeit mit Kiew, nein zur EU-Mitgliedschaft [der Ukraine].“ Der Platz in Budapest, von wo er in den Rat gereist war, hatte in Sprechchören explodiert. In Brüssel selbst wirkte sein Auftritt wie ein Schauprozess, der er plötzlich in einen Moment höchster Konfrontation verwandelte.
Der 140-Milliarden-Euro-Geldkasten: Ein mafiöses Manöver
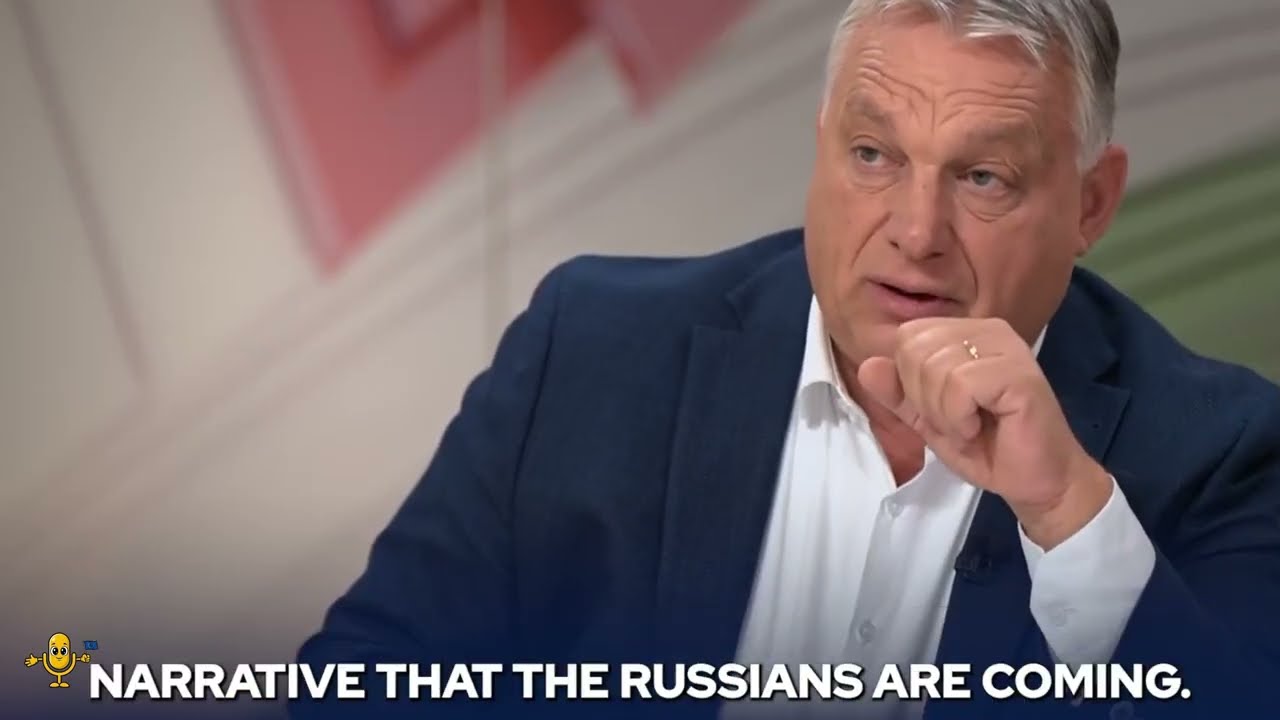
Die zweite Auseinandersetzung entzündete sich unmittelbar am Geld, und hier zeigte die Brüsseler Elite ihre schärfsten Zähne. Die Botschaft an die Mitgliedsstaaten war unverblümt und beinahe mafiös: Akzeptiert den Plan zur Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte, oder das gesamte Kriegsfinanzierungssystem bricht zusammen.
Der Vorschlag war technisch und juristisch verschleiert: Die Tresore mit den Hunderten Milliarden bei Euroclear und anderen Banken sollten geöffnet und die Erträge direkt an die Ukraine weitergeleitet werden. Die 140 Milliarden Euro wurden als “clevere Buchführung” verkauft, abgesichert durch einen Sonderfonds aus Staatsanleihen. Doch der eigentliche Zweck war ein Manöver, um das Einstimmigkeitsprinzip im Rat zu umgehen und Orbáns Veto zu entkräften.
Péter Szijjártó, Orbáns rechte Hand, wetterte mit brennender Wut gegen diesen Plan. Er warf Brüssel vor, die Souveränität mit Füßen zu treten und EU-Recht in eine politische Waffe zu verwandeln. Anstatt sich den wirklichen Herausforderungen Europas zu stellen – der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, der Sicherung der Energieversorgung und dem Wiederaufbau des Wachstums – konzentriere sich Brüssel obsessiv auf die Finanzierung des Krieges. Doch Brüssel zuckte nicht. Hinter verschlossenen Türen kursierten bereits Flüstern über juristische Schlupflöcher, um das Paket auch ohne Ungarns Zustimmung voranzutreiben. Verfahren spielten keine Rolle mehr, nur noch das Momentum.
Der unerwartete Rebell: Belgien durchbricht die Fassade der Einheit
Gerade in diesem Moment der vermeintlichen Überlegenheit der Bürokratie, als Brüssel glaubte, den ungarischen Rebellen endlich ausmanövriert zu haben, erhob sich eine unerwartete zweite Front. Ausgerechnet Belgien, traditionell einer der loyalsten Partner in der EU, durchbrach das diplomatische Theater mit brutaler Ehrlichkeit und blockierte die gesamte Operation.
Bart De Wever, der belgische Premierminister, nannte den gesamten Kreditplan von 140 Milliarden Euro als „vollkommen wahnsinnig“. Während andere Staatschefs weiter von „Einheit“ murmelten, schlug er mit der Faust auf den Tisch und verlangte zu wissen: Wer garantiert, dass Belgien am Ende nicht für die „Spielschulden“ Europas aufkommen muss? Er sah Ursula von der Leyen direkt in die Augen und stellte sie zur Rede: „Wer wird die Verantwortung übernehmen, wenn alles zusammenbricht? Ihr oder die Menschen in meinem Land?“
De Wever nannte die Beschlagnahmung der russischen Vermögen ein „finanzielles Minenfeld“, eine leichtsinnige Idee, die das Vertrauen in das gesamte europäische Bankensystem unwiederbringlich zerstören könnte. Da ihm niemand die verlangte Garantie geben konnte, nutzte Belgien seinen Einfluss und blockierte die gesamte Operation. Die Abschlusserklärung des Rates, die ursprünglich das Darlehen absegnen sollte, wurde bis zur Unkenntlichkeit verwässert, ersetzt durch vage Versprechen künftiger Optionen.
Budapest als Hauptstadt des Friedens: Das Beben nach dem Gipfel
Die Wut im Brüsseler Hauptquartier war spürbar. Der Gipfel, der Europas Einigkeit demonstrieren sollte, endete mit einem bizarren, aber entscheidenden Ergebnis: Belgien hatte sich an Ungarns Seite gestellt, und gemeinsam siegten sie. Ein kleines Land, das tagelang massiven Druck durch die Brüsseler Elite erfahren hatte, spielte gerade die mächtigste Bürokratie Europas aus.
Der europäische Rat ging im Chaos zu Ende. Orbán war direkt vom Budapester Friedensmarsch nach Brüssel gereist und hatte innerhalb weniger Stunden zwei Fronten entzündet: Rebellion im Osten und fundamentale Zweifel im Westen. Nur wenige Staatschefs können solche Erschütterungen auslösen, einfach indem sie aufstehen und ein kompromissloses „Nein“ aussprechen.
Orbáns Stuhl blieb leer, doch seine Worte hallten lauter wider als je zuvor. Die Botschaft, die von diesem chaotischen Gipfel ausging, ist eindeutig: Die EU-Elite kann zwar weiterhin versuchen, ihre ideologischen und finanziellen Pläne unter Ausschluss des Volkes voranzutreiben, doch der Widerstand wächst. Ob aus leidenschaftlichem Patriotismus wie in Ungarn oder aus pragmatischer Sorge um das eigene Bankensystem wie in Belgien – die Mauern der vermeintlichen Einheit beginnen zu bröckeln. Die Zeit, in der die Brüsseler Bürokratie unangefochten über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden konnte, scheint endgültig vorbei zu sein. Der „Wolf“, wie Orbán von seinen Gegnern genannt wird, ist gekommen, um Europa vom Abgrund des Eskalationswahns zurückzuholen.




